![]()
Der Untergang der Musikindustrie
Die Musikindustrie wird in Zukunft weiter stark an Bedeutung verlieren, die grossen Konzerne werden mit der Zeit entsprechend zurückschrumpfen und sich schlussendlich praktisch ganz auflösen. Was nicht bedeutet, dass es weniger Musik geben wird. Aber eben auf anderen Wegen.
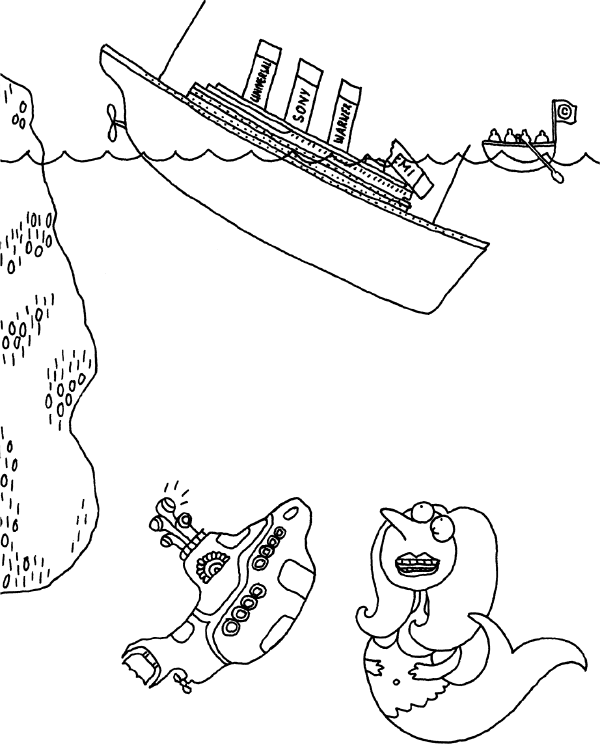
Gründe für den Zerfall der Musikindustrie
Die Geschichte der Musikindustrie begann mit der Geschichte des Tonträgers und wird mehr oder weniger gleichzeitig auch mit ihr enden. Lange Zeit hatte die Musikindustrie bei der Produktion und Vervielfältigung von Tonträgern eine Monopolstellung inne, was auch ihre Existenzgrundlage war. Denn Musiker und Publikum konnten selbst keine Platten herstellen oder kopieren. Also war die Musikindustrie diesbezüglich der einzige mögliche Ansprechpartner.
Musikkassette
Dies hat sich ab den Sechziger Jahren mit der Musikkassette geändert; plötzlich konnte man selbst die Musik in akzeptabler Qualität vervielfältigen. Und auch günstig aufnehmen; sehr populär bei Bands waren damals die Vierspuren-Kassettenrekorder, die handelsübliche Kassetten mit immerhin vier separaten Spuren gleichzeitig oder zeitlich versetzt bespielen konnten. Das war zwar alles noch Low-Quality, genügte aber vielen bereits. Die Musikkassette war bis Ende des Jahrtausends sehr verbreitet, in Schwellenländern sogar heute noch. Die Musikindustrie startete wegen befürchteter Umsatzeinbussen in den Achtziger Jahren die Anti-Kopier-Kampagne «Home Taping Is Killing Music».
Das digitale Zeitalter
Die zweite einschneidende Änderung war die Möglichkeit, Audiodaten von der CD auf den Computer zu kopieren, und die Einführung brennbarer CD-ROMs. Zwar eigentlich für das Bespielen von Daten gedacht, haben die Konsumenten aber sehr schnell herausgefunden, dass auch Audio-CDs ohne weiteres kopiert werden können. Und diese dann nicht mal nur auf dem Computer laufen, sondern auch in sehr vielen CD-Playern. Dies wurde Ende der Neunziger Jahre sehr populär.
Die dritte Veränderung des Konsumverhaltens kam kurze Zeit später mit dem wachsenden und immer schneller werdenden Zugang zum Internet. Mittels MP3-Kompression konnte nun schier endlos Musik relativ einfach und schnell heruntergeladen und ausgetauscht werden, und das bei exzellenter Qualität. Es wurde «normal», Tausende von Songs von Hunderten Interpreten in seiner Sammlung zu haben. Dies freut sich seit der Jahrtausendwende ungebrochener Beliebtheit.
Die Musikindustrie reagierte darauf erneut mit der Ächtung von Musik-Kopierern, und immer neuen Kopierschutz-Varianten auf den Kauf-CDs. Und online angebotene MP3s beinhalteten anfänglich ebenfalls einen Kopierschutz.
Die bösen, bösen «Raubkopierer»
Dass die Musikindustrie nicht viel Freude findet an dieser Entwicklung, leuchtet soweit ein. Allerdings ist es auch zu einfach, überall das dafür extra erfundene Schlagwort «Raubkopie» und «illegaler Download» zu gebrauchen. Man überlege mal: Zum einen heisst es eigentlich «stehlen» – «rauben» hingegen beinhaltet auch immer noch einen Akt der Gewalt. Und zum anderen: stehlen kann man nur ein Original. Eine Kopie ist eine Kopie ist eine Kopie. Auch das Wort «Piraterie» wird oft für diese Sündenbockkonsumenten zweckentfremdet. Heruntergeladene Gratis-Downloads, also Daten, die frei verfügbar sind, können aber streng genommen gar nicht illegal sein. Wer dies bestreitet, hat das Wesen des Internets als anarchischer Superorganismus nicht verstanden.
Ja, aber die Nutzung! Schon klar, aber es genügt nicht, über irgendwelche in unverständlicher Juristensprache verfassten Lizenzen und unter Androhung von massiven Strafen den Leuten vorzuschreiben, was sie in ihren eigenen vier Wänden dürfen und was nicht. Das ist eine Beschneidung der Privatsphäre und funktioniert so nicht! Beziehungsweise es schafft automatisch auch starke Gegenpole und Anreize, diese Regelung zu umgehen. Vor allem, wenn die Bedingungen so unklar definiert sind wie im Bereich der Musikdownloads. Und erst recht dann, wenn der ehrliche Konsument derart verärgert ist, weil die CD, die er sich gerade gekauft hat, wegen des krassen Kopierschutzes in seinem Autoradio nicht läuft.
Jedenfalls hat sich in jüngster Zeit die Musikindustrie mit dem ständigen Beschimpfen und Verunsichern der Konsumenten keinen guten Namen gemacht und wohl bei so manchem eher das Gegenteil erreicht. Vor allem hierzulande, denn viele Aussagen der Musikindustrie und Medien stimmen überhaupt nicht mit der tatsächlichen rechtlichen Situation überein.
Im Filmbusiness wurde ebenfalls reagiert, als das Kopieren und Herunterladen von Filmen populär wurde. Wahnsinnig sympathisch: dort werden die «Raubkopierer» sogar als Verbrecher dargestellt. Diese Kampagnen liefen auch in unseren Kinos und sind auf hier erhältlichen DVDs drauf, jedoch eigentlich rechtswidrigerweise, denn das private Kopieren ist in der Schweiz seit jeher ausdrücklich erlaubt. Man muss sich jetzt mal die Unsicherheit des Konsumenten und auch daraus entstehende Trotzreaktionen vorstellen! Bravo! Super gemacht, liebe Industrie!
Kein Dialog unter den Parteien
Die Musikindustrie wird immer wieder mit diversen Vorwürfen belastet, die sie selbst als «Vorurteile» bezeichnet. Und ihrerseits wiederum den Gegnern Unseriosität, Kriminalität und Realitätsverkennung an den Kopf wirft. Die Fronten sind verhärtet. Schaut man sich beider Aussagen einmal an, lässt sich feststellen, dass auf beiden Seiten massive Überlegungsfehler gemacht und die jeweiligen Argumente oft deutlich überzeichnet werden. Ein Kindergarten. Auch der Industrie sollte soweit klar sein, dass eine Gegenbewegung als Ursache auch immer einen gewissen Unmut erfordert. Und den Gegnern sollte klar sein, dass sich seinerzeit auch schon die Hippies erfolglos gegen das «System» aufgelehnt hatten. Das einfachste wäre wohl, wenn alle Parteien vernünftig zusammenhocken, sich ausreden und des anderen Bedürfnisse anhören würden. Wird aber nicht gemacht. Schade. Denn ob all dem Gegacker stellt niemand die Frage: «Was wollen die Leute denn eigentlich?» oder «Wie könnten wir das Problem gemeinsam lösen?»
Die Industrie wird nicht mehr benötigt
Fakt ist: der Musikindustrie entgleitet mit dem allmählichen Verschwinden des Tonträgers ihre Existenzberechtigung. Denn jahrzehntelang waren nur professionelle Studios überhaupt fähig, Musik aufzunehmen, weiterzubearbeiten und anschliessend im Presswerk zu produzieren und herauszugeben. Heutzutage können aber selbst mit einem Low-Budget-PC ganz passable Musikproduktionen und Bandaufnahmen erstellt werden. Der Rest ist Know-How und/oder ausprobieren. Und für die weltweite Publikation muss man auch nicht mehr bei einem Label unter Vertrag sein: ein YouTube-Video oder ein Homepage-Link genügen. Und das ist sogar gratis und ohne Verpflichtung. Ein weiterer Vorteil: die Beliebtheit eines Videos (= die Anzahl Klicks) ist hier sogar eine ziemlich direkte Rückmeldung, also quasi eine «echtere» Hitparade.
Gesättigter Bedarf
Auf eine für etwas mehr als Fr. 100.– erhältliche 2-Terabyte-Festplatte passen etwa 2 Millionen Minuten Musik von allerbester Hörqualität. Das entspricht einer fast vier Jahre dauernden 24-Stunden-Nonstop-Playlist, ohne dass ein einziger Song zweimal läuft. Das reicht für mehr als das ganze Leben; es ist sogar praktisch unmöglich, das alles wenigstens einmal durchzuhören. Und das ist nur ein Bruchteil der im Internet verfügbaren Musik. Der Bedarf an neuen Tonträgern ist rein mengenmässig also schon längst gesättigt.
Keine Bewegungen mehr
Der Musikindustrie sind die Neuheiten ausgegangen. Musikstile haben sich immer schon verändert und sind eine Mischung zwischen der regionalen Kultur, den persönlichen Bedürfnissen und den verfügbaren Instrumenten. Im 20. Jahrhundert nahm, auch dank der globalen Verbreitung der Musik durch die Industrie, die Vielfalt an Stilen rasant zu. Vor allem aber auch dank der immer grösser werdenden Palette an Instrumenten und dem einfacheren Zugang dazu. Dies hat zu einem regelrechten «Stilmarathon» geführt. Und zu sehr viel Umsatz für die Industrie, denn ein neuer Stil bedeutete immer auch neues, zusätzliches Zielpublikum.
Seit den Nachkriegsjahren war lange Zeit Musik und der entsprechende Stil eine Ausdrucksform der verschiedenen Jugendbewegungen und der einschneidenden gesellschaftlichen Veränderungen der letzten hundert Jahre. Dies hat der Industrie einen riesigen Aufschwung verliehen, ja war sogar der Hauptmotor. Diese «Jugendbewegungen» gab es davor übrigens nicht. Und gibt es auch heute nicht mehr: die verschiedenen Ausdrucksformen Jugendlicher haben sich schon längst untereinander vermischt und sind nicht mehr an soziale Herkunft oder Situationen gebunden. Es lässt sich keine eigentliche Bewegung mehr erkennen.
Keine neuen Stilrichtungen mehr
Real hatte die Diversität ihren Höhepunkt in den Neunziger Jahren. Die neuen Möglichkeiten der elektronischen Musik setzten den inzwischen zahlreichen Formen des Blues und Rock’n’Roll den Deckel auf und beendeten vorläufig das Rennen um die immer neuen Musikstile. Die letzte grosse Neuerung, wo auch noch eine echte Bewegung die treibende Kraft war, hiess Techno. Mit den vielfältigen musikalischen Variationen dazu. Die Technobewegung war aber anders als die vorhergehenden, eher rebellischen und auflehnenden Bewegungen: sie propagierten Liebe und Toleranz! Und setzten damit einen doch ganz versöhnlichen Abschluss, denn mit dem Ende des Jahrtausends endete auch die Technobewegung und damit die Jugendbewegungen überhaupt.
Und was ist mit all den Neuerungen seither? Es sind keine. Es sind Abwandlungen, Kopien, Kombinationen und Varianten bestehender Musik. Natürlich entsteht dadurch auch immer wieder etwas Neues, und die Unendlichkeit von Kreativität ist ja auch das Fantastische an der Musik. Aber im Mainstream sind keine prägenden musikalischen «Revolutionen» mehr geschehen seither.
Alles schon vorhanden
Zudem hat jedermann heute praktisch uneingeschränkten Zugang auf sämtliche Musikformen, die seit der Erfindung des Tonträgers entstanden sind. Die verschiedenen Musikrichtungen sind nur einen Fingertouch entfernt und ständig abrufbar. Was dazu führt, dass beispielsweise heutige Jugendliche gar nicht mehr immer nur nach Neuem lechzen, sondern sich auch mal etwas Vergangenes anhören. Dies ist neu; davor war die Musik auch immer ein Weg, sich von der Erwachsenengesellschaft abzugrenzen. Dieselbe Musik zu hören wie die Eltern, war jahrzehntelang ein No-Go! Dieser Graben ist heute jedoch entschärft, und Konflikte finden wohl noch immer statt, aber sie entladen sich nicht mehr zwingend über Produkte der Musikindustrie. Die uneingeschränkte Verfügbarkeit der Musikrichtungen lässt einen auch alles finden, was man benötigt: für jede Lebenslage, für jeden Stil, für jede Emotion. Dadurch wird die Nachfrage an Neuheiten ebenfalls stark geschwächt.
Pseudo-Neuheiten
Dies alles ist ein Desaster für die Musikindustrie und verstärkt den Effekt des verschwindenden Tonträgers dramatisch. Als Gegenreaktion werden nach wie vor «Neuerungen» auf den Markt gebracht und auch fulminant als solche angepriesen, die aber keine sind. Zwar sind es neue Namen von Künstlern und Bands, aber die meiste «neue» Musik hat man so oder leicht anders doch schon mal gehört. Das Tempo, mit dem neue Musikstile bis in die Neunziger Jahre herausgebracht wurden, wird künstlich aufrechterhalten, um den Absatz zu gewährleisten. Fürschi, fürschi.
Keine Qualitätsverbesserungen mehr
Nebst der musikalischen Neuerungen konnten die Musikindustrie und damit verbunden auch die Hersteller von Geräten jahrzehntelang immer wieder überraschen mit Verbesserungen der Soundqualität. Bei der Produktion, beim Medium und bei der Wiedergabe. Die maximale nötige Qualität für das menschliche Hörvermögen war mit dem Audio-CD-Standard Anfangs der Achtziger Jahre erreicht. Danach folgten nur noch Verbesserungen bei Aufnahme- und Wiedergabegeräten, welche aber ebenfalls bald erreicht waren und nun nur noch günstiger werden konnten. Die Elektronikindustrie hat seither neue Nischen gefunden, beispielsweise das 5.1-Surround-System und eine Vielzahl von MP3-Playern, um dem aufkommenden Format gerecht zu werden. Nicht so die Musikindustrie: sie konnte bezüglich Qualität in den letzten zwanzig Jahren mit keinen nennenswerten Verbesserungen aufwarten, da es eben gar nichts mehr zu verbessern gab. Dieses fehlende Argument trägt ebenfalls zur Umsatzeinbusse bei.
Das einzige, was diesbezüglich noch gemacht wird: es werden uralte Aufnahmen aufgearbeitet, neu gemastert, und mit entsprechend grosser Ankündigung nochmals auf den Markt gebracht. Doch auch das lutscht sich dann natürlich irgendwann aus.
Keine Qualität mehr
Natürlich, die Hauptumsatzzielgruppe ist der Mainstream, keine Frage. Und hier ist Erfolg heute hauptsächlich eine Frage des geschickten Marketings. Audiophile Hörer, die ein Vermögen für eine HiFi-Anlage ausgeben, sind eine Nischenpublikum, ganz klar. Doch etwas sollte nicht vergessen werden: im direkten Vergleich zu Mainstream-Teenies hat dieses Publikum zwei riesige Vorteile. Erstens sind sie ihren Künstlern oder ihrem Stil meistens lange Jahre treu. Und zweitens haben sie Geld. Das sie auch sehr gerne und manchmal scheinbar unlimitiert ausgeben für neue Releases ihrer Lieblingsbands oder ihres Lieblingsdirigenten. Schliesslich möchte man ja auf dem hochwertigen Masselaufwerk nur die beste Scheibe auflegen. Ein CD-Player? Nein, der Schallplattenspieler ist gemeint. Gibts denn noch viele Vinylalben? Nein, nur noch ganz wenige. Wenn nicht mehr viele Vinylalben erhältlich sind, wofür geben die HiFi-Freunde dann heutzutage Geld aus? Für den Plattenspieler.
Na gut, wenn die Plattenfreunde als relevantes Zielpublikum der Industrie nicht mehr in Frage kommen, es gibt ja auch sicher viele CD-Fans, die Wert auf Qualität legen und dafür viel Geld ausgeben? Ja, doch genau diese stören sich an der Kompression und am Clipping, das bei heutigen Produktionen immer häufiger und immer stärker angewendet wird (siehe «Loudness war»). Heute wird vor allem schnell produziert. Und billig. Dass hierbei nicht nur die rein technische, sondern auch die hörbare Qualität leidet, stört die Industrie nicht, solange die Kasse stimmt. Und bei einem Einfranken-Smartphone hört man das Clipping ja schliesslich auch nicht so deutlich wie bei einer zwanzigtausendfränkigen Stereoanlage. Womit auch hier wieder erwähnt wäre, wo das Geld hingeflossen ist – anstatt in die Kassen der grossen Labels.
Was bewegte die Major-Industrie zur Vernachlässigung dieser Kunden? Ignoranz? Arroganz? Dummheit? Man weiss es nicht. Aber eins ist klar: dieses Zielpublikum ist verloren. Das treuste und zahlungskräftigste. Vielleicht war es doch einfach nur Dummheit.
Videozug verpasst
Als die Musikindustrie 2003 mit ihrem Angebot online ging, hagelte es an Kritik, dieser Einstieg ins digitale Zeitalter sei viel zu spät unternommen worden. Kann sein. Wenn, dann hatte dies allerdings nur kurzfristige Einbussen zur Folge, denn die Industrie hat sehr schnell aufgeholt in diesem Bereich. Die Zuwachsahlen von online verfügbarer und verkaufter Musik explodierten geradezu und erreichten nach wenigen Jahren ein dem bisherigen Markt ebenbürtiges Niveau.
Doch ein wichtiger Zug, den die Industrie zwar gebaut hatte, aber vergass einzusteigen, war der Bereich Musikvideo. Ab Ende der Achtziger Jahre war ein attraktives Video zu einem potenziellen Hit Pflicht geworden. MTV und später VIVA wurden in den Neunzigern neben dem klassischen Radio zum Hauptwerbemedium der Musikindustrie, und für deren Produktion wurden riesige Summern ausgegeben. Egal, ob Nischenmusik oder Mainstream, ein Song ohne Video war quasi blutt.
Doch genau da lag und liegt auch heute noch das Problem: ein Musikvideo galt in der Augen der Industrie immer als Promotion, als ein reiner «Werbeträger» für den Song, nicht als erhältliches Produkt. Obwohl für ein Video zigfach höhere Kosten aufgewändet wurden als für die Produktion einer CD, musste dann der reine CD-Verkauf alles wieder einspielen. Die Videos aber konnte man nicht kaufen. Das einzige, was dann irgendwann aufkam, waren sinnlos überteuerte Musik-DVDs; allerdings zumeist nur Info-Dokus oder Live-Konzerte einer einzelnen Band, mit manchmal dem Videoclip als Zückerli drauf. Doch wer kauft sich so was? Nur die wenigen eingefleischten Fans. Einzelne Bands begannen dann zwar, zur normalen Audio-CD dem Album noch eine DVD beizulegen, blieben aber damit die grosse Ausnahme.
Ein fataler Fehler der Musikindustrie. Sie hätte Millionen verdienen können, wenn sie das Medium Video nicht nur als Werbung für Audio angeboten hätte. Die Videoclips erreichten damals sehr schnell riesige Beliebtheit; schliesslich waren sie Ausdruck einer neuen Kreativität und neuer technischer Effekte und Möglichkeiten, und entsprechend oft viel origineller als der Song selbst. Viele Clips schaute man sich nicht wegen der Songs an. Doch man war der Sendesouveränität der Musiksender ausgeliefert. Klar konnte man auf gut Glück den Videorekorder laufen lassen, aber sie dann zurechtzuschneiden ohne teures Equipment und deutlichen Qualitätsverlust war nicht möglich. Keine Chance also, sich seine persönliche Sammlung zusammenzustellen, wie man das damals gerne mit den Musikkassetten gemacht hat.
Die Produktion einer DVD kostet im Vergleich zur CD nur unwesentlich mehr. Warum gab es in den CD-Läden keine Musikclip-DVDs? Alle oder auch nur ein Clip einer Band zum Beispiel, oder Sampler, Hitparaden, Best-Of-Compilations etc.? Dasselbe Programm wie auch bei den Audio-CDs halt. Und zu einem ähnlichen Preis wie ein Album. Warum gab es das nicht, nicht mal in kleinerem Rahmen? Ich weiss es nicht. Es zeigt, wie träge die Musikindustrie mit Neuerungen umgeht und die tatsächliche Nachfrage verkennt. Denn eines weiss ich genau: wären solche Clip-Sammlungen auf DVD oder sogar schon auf VHS erhältlich gewesen, hätte ich nochmals ziemlich viel Geld dafür ausgegeben, selbst wenn ich dazu die Audio-CD bereits hatte. Denn ich war ein grosser Fan der Videoclips.
Und ich weiss, ich bin damit nicht der einzige. Dass die Nachfrage dazu eigentlich jahrelang schlummerte und von der Industrie ignoriert wurde, zeigte der bislang und auch seither noch nie dagewesene Aufstieg einer Internet-Startup-Firma: YouTube. Das Videoportal wurde im Februar 2005 in den USA gegründet und nur eineinhalb Jahre später für mehr als eineinhalb MILLIARDEN Franken an Google verkauft! Und was wurde anfangs nebst der privaten Filmli wohl am liebsten hochgeladen und angeschaut? Musikvideos natürlich! Endlich war eine Möglichkeit gegeben, seine Lieblingsclips von damals und heute nach Wunsch zu schauen. Super! YouTube hatte in diesem Bereich dann auch innert weniger Jahren MTV und andere Musiksender praktisch vollständig abgelöst.
Und was tat die Musikindustrie? Sie hat vergleichsweise spät realisiert, dass ja eigentlich das Uploaden und Bereitstellen der Videos eine Urheberrechtsverletzung darstellt und begonnen, YouTube zu verklagen und aufzufordern, die Videos vom Netz zu nehmen. Tatsächlich war lange Zeit nur noch ein kleiner Teil der Musikvideos online; ausserdem meistens in einer absichtlich miserablen Qualität. Immerhin: Seit neustem sind nun auch in der Schweiz ein Grossteil der Clips wieder freigeschaltet – durch das 2010 gestartete, werbefinanzierte Musikvideoprojekt «VEVO», welches Universal und Sony gehört. Und bei Music-TVs lässt sich schon seit längerem zwischen der ganzen SMS- und Klingeltonwerbung nur noch auf einem Bruchteil des Bildschirms überhaupt der Videoclip erkennen. Das Medium Video wurde also inzwischen fast komplett fallengelassen?
Könnte man meinen, ist aber nicht so: obwohl kaum mehr Kanäle existieren, wo ein Videclip störungsfrei geschaut werden kann, werden nach wie vor zu einem Hit aufwändige Clips realisiert mit einem Riesenbudget. Weshalb? Ganz einfach: die Industrie hat ihre Einnahmequelle schon längst ausgerichtet auf die mit den Clips verknüpfte Werbung; der Videoclip, egal ob Musikfernsehen oder YouTube, ist inzwischen nicht mehr nur ein Werbemedium für den Song, sondern ein Mittel, um den Zuschauer am Bildschirm zu behalten, damit er die Werbung sieht. Und nach wie vor gibt es keine erschwinglichen Videoclip-DVDs und auch keine Blueray-Kompilationen zu kaufen. Eigentlich sehr schade. Und auch sehr dumm.
Zu starres System
Die Marktstruktur und Lizenzen der Musikindustrie sind noch etwa dieselben wie vor 100 Jahren. Auch 20 Jahre nach dem Durchbruch des digitalen und vernetzten Zeitalters hat es die Industrie noch nicht geschafft, diese auf die gesellschaftlichen Veränderungen und neuen Möglichkeiten anzupassen. Sie haben zwar laufend ihre Produkte angepasst (verschiedene Musikstile, neue Tonträgerarten etc.), aber nicht ihre eigene Funktionsweise. Veränderungen geschehen aber immer. Dauernd. Jede andere Industrie muss sich auch ständig neu erfinden und nebst ihrer Produkte auch die eigenen Strukturen neu auf den Markt ausrichten, um das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage aufrechtzuerhalten. Diesbezüglich hat die Musikbranche aber ihre Hausaufgaben bis jetzt vernachlässigt, was sich nun mit jahrelangen Umsatzeinbussen rächt. Das Desinteresse der Konsumenten und die «Downloader» sind nicht die Ursache dieser Misere, sie sind deren Folge.
Zu gross für Kreativität
Die inzwischen entstandene Grösse der Musiklabels ist zwar ein Versuch, Ressourcen zu optimieren und damit wieder Gewinne zu schreiben. Allerdings wird genau dadurch auch der ganze Apparat derart träge und unflexibel, dass echte Neuheiten auf dem Markt praktisch unveröffentlichbar werden. Welche aber die grösste Chance für die Industrie wären, aus ihrem Abwärtsstrudel herauszukommen. Ausserdem haben auch bereits viele Bands und Künstler realisiert, dass der Traum von der grossen, freien Bühne und vom grossen Geld eben nur ein Traum war, die Musikindustrie dafür zu viele Fäden zu fest in der Hand hält und die Geldverteilung zu einseitig ist.
Sie wenden sich daher ab und suchen neue Möglichkeiten, ihre Musik zu publizieren. Und konzentrieren sich, und das ist eine zwar erst langsam entstehende, aber durchaus erfreuliche Entwicklung, nicht mehr so verbissen auf die Produktion und den Absatz von Tonträgern, sondern wieder vermehrt auf Live-Auftritte und den direkteren Kontakt zum Publikum. Was insgesamt das Musikschaffen wieder stark belebt und auch wieder erlebbar macht. Ein Gewinn für die Musik. Aber der Industrie kommt dadurch ihr letztes, grosses und zentrales Kapital abhanden: die Kreativität der Künstler und die Künstler selbst, als Repräsentanten der Musik.
Publikumsfremd
Mit dem «Weichwaschen» von Popmusik und der alltäglichen Präsenz des austauschbaren Mainstreams durch die starke Abhängigkeit der Radiostationen zielt die Musikindustrie je länger je weiter am Publikum vorbei. Nicht alle möchten immer nur Abgekupfertes, neu Aufgelegtes, Vordefiniertes, allzu Braves und Ohr-Optimiertes hören. Es sind auch nicht alle Fan von der Tatsache, dass sie während der Arbeit oder des Einkaufens ständig «berieselt» werden. Und je mehr die Popmusik – auch an Livekonzerten – in diese Richtung verkommt, umso stärker wird das Bedürfnis der Leute nach «echten» Emotionen. Welche aber im grossen Musikzirkus fast nirgendwo mehr zu finden sind. Also wenden Sie sich ebenfalls ab und suchen anderswo nach Medien und Musik, die sie zum Lachen, Tanzen oder Weinen bringen. Und finden sie im Internet.
Durch dieses jahrelange, konsequent gesteigerte Ignorieren der tatsächlichen Nachfrage am Markt kommt der Industrie ihre Produkteabnehmer, also die Musikkonsumenten abhanden. Reagieren darauf kann sie auf Grund des übergrossen Apparats nur sehr schwerfällig. Die daraus folgenden Umsatzeinbussen sind selbsterklärend und letztendlich auch vernichtend.
Es lässt sich also zusammenfassen:
• Der bevorstehende Untergang der Musikindustrie, so wie sie heute funktioniert, ist eine Frage der Zeit und eine logische Folge der bisherigen Historie.
• Das viel gehörte Argument des «Raubkopierens» ist nichts anderes als ein Rettungsversuch der Musikindustrie, um rechtliche Massnahmen zu legitimieren und so den Umsatzrückgang aufzuhalten oder mindestens zu verlangsamen.
• Die «Raubkopierer» an sich tragen nur zu einem nur kleinen Teil bei zum Untergang der Musikindustrie. Statistiken zeigen, dass auch in Ländern mit stark rückläufiger «illegaler Downloadrate» die Umsätze dennoch nicht wie erhofft ansteigen. Massgeblich sind vor allem die vorher beschrieben anderen Gründe. Dass die Industrie aber alle Schuld einzig auf die «Internetpiraten» abwälzt und kein anderes Argument bringt, und den Konsumenten andererseits aber auch kaum mehr positive Anreize liefern kann, ihre Musik zu kaufen, zeugt von ihrer aktuellen Verzweiflung.
• Das auf der Gegenseite viel gehörte Argument, die Industrie habe das digitale Zeitalter verschlafen, kann man zwar gelten lassen: tatsächlich wirken zu viele Verhaltensweisen der Musikindustrie eher wie Trittbrettsprünge auf bereits fahrende Züge – oder wie Gegenmassnahmen, um andere Züge zu bremsen. Allerdings hat dieses Argument auch keine Bedeutung: die Industrie geht wegen des Verschwinden des Tonträgers und wegen der anderen zuvor beschriebenen Ursachen als logische Konsequenz so oder so den Bach ab.
• Die Musikindustrie hat das Marktpotenzial des Tonträgers voll und ganz ab- und ausgeschöpft, ist aber inzwischen zu massig geworden, um auf die neuen Nachfragen und Kommunikationswege des Publikums genügend rasch reagieren zu können.
Kann die Musikindustrie, so wie sie heute ist, ihren Untergang aufhalten?
Nein.
Was wird bis dahin noch geschehen?
Musik-, Event- und Medienkonzerne werden noch stärker miteinander verschmelzen, als es heute bereits der Fall ist; mediale Unterhaltung und Beeinflussung wird dann ein komplettes Gesamtprodukt eines einzelnen Unternehmens sein, wo Unterschiede verschiedener Quellen nicht mehr feststellbar sind. Das bedeutet: die Omnipräsenz von musikalischem Einheitsbrei und aufgewärmten Klischees wird noch eine Zeit lang so weitergehen und sich nochmals massiv verstärken. Gleichzeitig wird sich aber das Bedürfnis des Publikums durch die massive Reizübersättigung und Entfremdung der kommerziellen Musik wieder vermehrt an der Basis orientieren: dem Musiker an sich. Und sich erfreuen an den handgemachten, persönlichen Aufnahmen und den intimen, kleinen Konzerten.
Dann wird sich auch künstlich eine rentierende Nachfrage nicht mehr auf Dauer aufrechterhalten lassen, was das Ende der heutigen Musikindustrie besiegeln wird. So grosse Konzerne können sich jedoch nicht einfach in Luft auflösen. Die Konzerne und Strukturen der Industrie werden, wie das auch schon bei anderen todgeweihten Industrien der Fall war, Konkurs gehen, sich auflösen, durchmischen mit anderen Unternehmen, verkleinern, etwas Neues beginnen. Die Musikindustrie in der heutigen Form wird dann nicht mehr erkennbar sein.
Die kleineren Independent-Labels wird das weniger stark und weniger schnell betreffen. Doch auch hier wird sich der Einbruch des Musikmarkts deutlich bemerkbar machen. Allerdings sind die kleinen Labels und Studios flexibler und daher eher in der Lage, ihr Geschäftsmodell den Veränderungen anzupassen.
Wann wird das soweit sein?
Aufgrund der bisherigen Historie, der Gegenmassnahmen der Industrie und der Entwicklungsgeschwindigkeit im Internet wird das wohl in den nächsten 10 bis 20 Jahren passieren. Allerdings wird es auch keinen eindeutigen Chlapf geben, sondern langsam und über einen längeren Zeitraum geschehen. Es zeichnet sich aber ab, dass es 2030 die Musikindustrie mit den übergrossen Plattenfirmen so nicht mehr geben wird.
Womit lässt sich der Untergang der heutigen Musikindustrie vergleichen?
Mit der Titanic. Vor einhundert Jahren war das damals grösste Passagierschiff der Welt zu schnell unterwegs, konnte wegen seiner Grösse und Trägheit dem Eisberg nicht ausweichen und sank.
Der Eisberg der Musikindustrie ist das Internet. Sie ist bereits am sinken.
Unaufhaltsam.
Unerträglich langsam.
Was bedeutet das für die Musik und für die Musikschaffenden?
Nichts. Musikschaffende schaffen Musik, weil sie Musik schaffen wollen. Weil sie einfach nicht anders können. Weil es ihnen Spass macht. Daran ändert auch der Untergang der Musikindustrie nichts. Die Musiker werden weiterhin Musik machen und ihre Hörer finden, und sehr wahrscheinlich dank der neu eröffneten Möglichkeiten auch wieder mit einer gewissen Unbefangenheit und einem direkteren Draht zum Publikum.
Für die Musikhörer bedeutet dies ebenfalls kein Verlust – im Gegenteil. Die musikalische Authentizität und damit der musikalische Genuss werden dadurch wieder zunehmen. Und Nostalgiker haben dann ja nach wie vor ihre riesige MP3-Sammlung aus fast 150 Jahren Tonträgergeschichte.
Das bedeutet, es werden keine neuen Songs mehr veröffentlicht und keine grossen Konzerte mehr veranstaltet werden?
Blödsinn. Natürlich werden sie das. Allerdings werden sich Bands wieder vermehrt an kleinere Labels und Studios richten, die es in dieser oder einer anderen Form noch geben wird, und die inzwischen neue Absatzmärkte und -konzepte entdeckt haben.
Und die grossen Konzerte wird es nach wie vor geben, genauso wie die kleinen. Welche Bands dabei auf den Bühnen stehen werden, wird sich zeigen. Insgesamt wird das Erleben von Musik, ob real oder mittels digitaler Echtzeit-Übertragungen, sogar wieder mehr Livecharakter erhalten, als es heute der Fall ist.
Weshalb es die Musikindustrie trotzdem (noch) braucht
Ganz so einfach ist es, und ganz so schnell geht es natürlich nicht. Der Untergang der Musikindustrie ist zwar Tatsache, wird sich aber noch eine quälende Zeit lang hinziehen. Und Neuerungen entstehen nie automatisch, sondern durch Leute, die Innovationen umsetzen und sich dadurch dem sich verändernden Markt anpassen oder sogar neue Märkte generieren können. Im Folgenden einige Bereiche, wo die Industrie nach wie vor ihre Stellung hält, und wo in Zukunft noch einige Veränderungen zu erwarten und auch zu erhoffen sind.
Und danach einige Ideen, Anregungen und Möglichkeiten, wie und wo die Zukunft gestaltet werden könnte.
Die Musikauswahl
Nebst der Bereiche, wo die Industrie nicht mehr zwingend benötigt wird oder eine Monopolstellung innehat, gibt es eine wichtige Aufgabe, die nach wie vor hauptsächlich von der Musikindustrie wahrgenommen wird: die Auswahl. Kein normaler Musikkonsument kann oder möchte sich durch Tausende von Bands durchhören, um herauszufinden, welches Dutzend davon ein hörbares Niveau haben und ihm wirklich gefallen. Daher braucht es jemanden, der bestehende Musik nach verschiedensten Kriterien filtert und dann nur diese auf dem Markt promotet. Denn wie bereits erwähnt: nur eine von zehn Bands ist erfolgreich – dies ist aber keine «Machenschaft» der Industrie, sondern eine Frage der Nachfrage. Der Bedarf an Musik ist nicht grenzenlos, und von zehn Bands können unmöglich alle gleich viel Erfolg haben.
Würde keine Auswahl stattfinden und würden nicht einzelne wenige Acts promotet, käme keine einzige der Bands auf ein «gewinnbringendes» Erfolgsniveau. Grosse Konzerte mit grosser Bühnenshow wären dann gar nicht mehr möglich, ebensowenig grosse Hypes, grosse Fangemeinschaften, grosse Skandale um die Künstler etc. Doch: die Leute wollen das. Das Publikum möchte eine Band, die sie bewundern können, einen Künstler, zu dem sie aufschauen können. Sie möchten sich in einer Fangemeinschaft verstanden fühlen und suchen entsprechend Gleichgesinnte. Sie möchten Empfehlungen hören und weitergeben, lassen sich anstecken von der allgemeinen Stimmung an einem Konzert oder in der Disco. Musik hören und erleben ist viel mehr als nur etwas, das man für sich alleine tut. Dies bedingt also eine gewisse Bekanntheit der Band.
Musiker müssen aktiv unterstützt werden
Also alles in Ordnung, die Fangemeinschaften und die Beliebtheit einer Band wachsen, wenn die Musik gut ist, ja von selbst? Mitnichten. Auch wenn am Radio und anderswo gerne das Gegenteil behauptet wird: es gibt keinen eigentlichen Hype. Respektive nur die eigentliche Wortbedeutung davon: ein Hype ist ein durch Massenmedien mittels überzeichneter, aufgebauschter und aggressiver Werbung und Berichterstattung ausgelöstes Konsumverhalten. Die Beliebtheit eines Künstlers kann sich zwar von alleine steigern, das ist richtig. Jedoch nicht in dem Tempo und in dem Ausmass, wie es für einen überregionalen Konsumansturm und die dadurch erst mögliche «Grösse» der Band nötig wäre. Erst recht nicht auf internationaler Ebene.
Um das zu erreichen, muss die Band und deren Karriere aktiv durch Promotion unterstützt werden. Es gibt keine «Selbstläufer» von 0 auf 100, dafür sind Musikhörer zu wenig «aktiv». Nicht vergessen: Musik ist ein Konsumgut. Und konsumieren bedeutet konsumieren; also nicht nachforschen, analysieren, vergleichen und sich drum kümmern müssen. Sondern hinsetzen und geniessen, in den Club gehen und abtanzen, ans Konzert gehen und staunen können.
Zwar kann heute mit Audio- und Videoportalen jeder völlig frei auch selbst «seine» Musik entdecken und sich mit anderen darüber austauschen. Diese «Mühe» machen sich allerdings die allerwenigsten.
Daher braucht es unbedingt Leute, die sich durch die schier unendliche Fülle an Tonträgern und aktiven Bands durchhören und entsprechend selektionieren. Und dann die ausgewählten Acts eben unterstützen, promoten, und um die Künstler einen Hype generieren. Diese Leute finden sich im Musikbusiness; sie haben das Know-How, die nötigen Kontakte und die Mittel, um dies zu tun und auch umzusetzen.
Dieser Umstand ist nichts Neues. Allerdings: je mehr Vielfalt bei den Labels, also bei den Leuten, die «auswählen», desto mehr Vielfalt natürlich auch im Musikmarkt. So ist heutzutage die Frage berechtigt, ob denn die Auswahl nicht zu einseitig ist, da es ja kaum mehr kleinere Labels gibt und der Mainstream zur Zeit von drei übergrossen Plattenfirmen bestimmt wird.
Das nur langsame Wenden des Blatts
Die Aufgabe des Auswählens wird dieser Tage, da nach wie vor die allermeisten Musiker und auch die wichtigsten musikverbreitenden Medien sich dem klassischen Markt anschliessen, immer noch hauptsächlich von der altbekannten Musikindustrie wahrgenommen. Entsprechende alternative Stellen, zum Beispiel im Online-Bereich, sind noch nicht als Bewegung wahrnehmbar. Dies wird sich erst ändern, sobald mehr und mehr Radiostationen auch anders lizenzierte Musik abspielen. Und mehr und mehr Musikschaffende sich vom bestehenden kommerziellen Modell weg zu neuen Möglichkeiten hinbewegen. Das Schwarzweissprinzip einer Suisa-Mitgliedschaft ist hierbei jedoch ein Punkt von zentraler Bedeutung (und somit eines der «Rettungsboote» der Industrie), denn Suisa gleich klassisch-kommerziell und nichts anderes. Möchte also ein Künstler neue Wege gehen, muss er sich quasi vollumfänglich aus dem heutigen Musikmarkt ausschliessen, was für ihn mitunter eine schwierige Entscheidung und eine grosse Hürde darstellt.
Es wird also noch ein ganzes Weilchen dauern, bis hier erkennbare tatsächliche Alternativen vorhanden sind, welche dem Konsumgut Musik zu seinem Publikum verhelfen mit einer vergleichbaren Qualität, wie dies die heutige Industrie bewerkstelligt. Je einseitiger die von der Industrie gebotene Auswahlqualität hingegen wird, umso eher steigt beim Konsumenten die Nachfrage nach Alternativen, was wiederum anderen Musikmarktmodellen Aufschwung verleihen wird. Nebst der vielen unter anderem durch das Internet beschleunigten Faktoren, die zum Untergang der Musikindustrie führen, ist dieser Prozess hier jedoch der zähflüssigste, da die Industrie und in ihrer starken Abhängigkeit auch viele Medien kein Interesse an neuen Modellen haben und ihre monopolistische Aufgabe des Auswählens sehr gerne und möglichst lange wahrnehmen werden.
Hits aus der Schublade – der Trend
Und: die Industrie hat einen immensen Fundus aus potenziellen Erfolgsbringern, die jederzeit bei Bedarf eingesetzt werden können, um die Nachfrage erneut zu befriedigen. Man erinnere sich an die anderen neun der zehn Bands. Erfolg ist austauschbar, und es stehen genug Künstler Schlange. Bei dieser Gelegenheit gleich auch noch ein Phänomen erklärt zum Thema «Trends»: hat eine Band mit einem neuartigen Musikstil ihren Durchbruch, fällt auf, dass äussert kurze Zeit später diverse Bands in den Charts erscheinen, die einen sehr ähnlichen Musikstil spielen; angeblich schon seit Jahren, allerdings hat zuvor noch nie jemand von diesen Bands gehört. Die Zeitspanne ist dabei so kurz (einige Wochen), dass es eigentlich unmöglich ist, sich in dieser Zeit vom neuen Stil der erfolgreichen Band inspirieren zu lassen, dazu Songs zu schreiben, sie produzieren zu lassen und langsam an Bekanntheit zu gewinnen (wofür es mindestens einige Monate wenn nicht gar Jahre bräuchte).
Wie geht denn das? Ganz einfach: die Bands gibts tatsächlich schon, und vielleicht haben sogar einige von ihnen tatsächlich schon länger einen ganz ähnlichen Musikstil (eine reelle Chance bei diesen Abertausenden von Bands). Nur, der Bedarf war bis anhin gar nicht vorhanden, also wurden diese Neulinge auch nicht speziell promotet. Nun passiert folgendes: die eine Band mit dem neuen Stil hat also ihren Durchbruch – mindestens so gross, dass ein neues Zielpublikum und eine neue Nachfrage erkennbar ist. Vielleicht sogar bei einem Independent-Label, da diese ja am ehesten fähig sind, Ungehörtes zu fördern. Die Konkurrenz- und vor allem die Majorlabels möchten aber nicht nachsitzen und suchen folglich in ihrer Kartei nach Bands mit Potenzial in einem ähnlichen Stilbereich. Hier wird alsodann die volle Promotionskraft eingesetzt; kurze Zeit später sitzt die eigene Band ebenfalls in den Charts. Dies ist zwar wie Poker spielen und gelingt beileibe nicht immer. Doch häufig, und sonst vielleicht mit der nächsten Band. Und natürlich sucht auch das «Mutterlabel» in ihren Reihen nach weiteren Acts, die ebenfalls in dieses Genre passen könnten. Und bereits erfolgreiche Künstler lassen sich von den Neulingen natürlich ebenfalls «inspirieren» und bauen entsprechende Elemente in ihre eigene Musik mit ein.
Der Musikkonsument selbst bekommt von diesen Mechanismen nicht viel mit, da in der Regel kaum erwähnt wird, welches Label hinter welcher Band steht, oder welche tatsächlichen Hintergründe zum plötzlichen Erfolg dieser und jener Band führten. Er sieht respektive hört plötzlich diverse Bands, die alle in diesem neuartigen Stil spielen. Und erkennt diesen Umstand als Trend. Falls dann der Zug ins Rollen kommt, und sich tatsächlich eine stetig und schnell wachsende Nachfrage in diesem Stilbereich abzeichnet, kommt es zur Steigerung des Trends: dem Hype.
Der entlarvte Hype
Wie gesagt, nichts Neues im Westen. Neu ist nur, dass immer weniger immer grössere Labels praktisch sämtliche Fäden in der Hand halten. Und dadurch «echte», also von den Bands aus kommende und publikumsbasierte neue Trends mehr und mehr erschweren. Und damit den Schritt zum gewinnbringenden Hype nahezu verunmöglichen: wird ein Hype als solcher offensichtlich, verliert er an Wirkung. Ein Hype gar ohne tatsächlichen Trend als Basis ist extrem kurzzeitig und praktisch wirkungslos, vor allem wenn man das dazu ausgegebene Werbebudget mit einberechnet.
Kein Problem, die nächsten Künstler stehen ja bereits in den Startlöchern. Allerdings, wie lange noch? Sobald neue, innovative Bands mehr und mehr auf alternative Musikmodelle setzen werden und jene dadurch an Bekanntheit und Beliebtheit zunehmen, wird auch die gigantische «Mediathek» der grossen Labels an Bedeutung verlieren.
![]()
