![]()
Tonträger, von analog über digital bis gestreamt
Dieses Thema hat rein erklärenden Charakter und eigentlich gar nichts direkt mit der Musikindustrie zu tun. Oder eben doch. Denn Aufstieg, Höhenflug und Fall der Musikindustrie sind sehr stark verbunden mit der Geschichte der Tonträger.
Was ist analoge Musik?
Musik ist grundsätzlich immer analog. Sie entsteht in erster Linie durch das Spielen von Instrumenten, das Vibrieren der Stimmbänder beim Singen, oder den Bewegungen der magnetgesteuerten Lautsprechermembrane. Dadurch wird die Umgebungsluft in Schwingungen (= sich in einer bestimmten Frequenz wiederholende Druckunterschiede) versetzt, die sich mit Schallgeschwindigkeit ausbreiten. Das trifft dann auf unser Ohr, welches die Schwingungen zusammen mit dem Gehirn auswerten kann und sie uns als Musik erkennen lässt.
Da eine Basssaite, Luft und unser Ohr nicht mit Bytes und Bits funktionieren, ist dieser gesamte Ablauf immer «analog». Das bedeutet, diese Schwingungen sind echte physikalische Schwingungen.
Vorgeschichte des Tonträgers
Da Musik ja irgendwie erzeugt werden muss, um an unser Ohr zu gelangen, war sie immer eine rein spontane Kunstform. Ganz im Gegensatz zu einem gemalten Bild, das ja bestehen bleibt, sobald man es gemalt hat (natürlich abhängig vom Material, wie lange). Dass Musik auch festgehalten und ohne Musiker oder Instrumente wiedergegeben werden kann, war lange Zeit unmöglich.
Dies änderte sich erst mit der Erfindung der Drehorgel in Deutschland irgendwann im 16. bis 17. Jahrhundert, die von Anfang des 18. Jahrhunderts bis vor hundert Jahren grosse Verbreitung und Popularität genoss. Mit der Drehorgel einher ging auch die Erfindung und Verbreitung sogenannter Flötenuhren, also Uhrwerken mit integrierter Metallpfeifen-Mini-Orgel, die beispielsweise zum Stundenschlag ein Stück abspielten. Flötenuhren waren sehr edle und teure Stücke und daher eher in gehobenen Kreisen verbreitet; die Drehorgel dagegen gehörte zum alltäglichen Strassenbild.
Zwar war die Drehorgel noch ein eigentliches Instrument, das die Klänge selbst erzeugt. Aber sie war transportabel, und man musste keine Tastenorgel mehr spielen oder Noten lesen können, um ein Stück zu spielen. Denn gesteuert wurden die Orgelpfeifen durch eine Stiftwalze. Ende des 18. Jahrhunderts wurde davon (von einem Schweizer ;-) die Miniaturvariante erfunden: die Musikdose. Hier brachten auf einem Metallzylinder montierte Stifte die nahe anliegenden Metallplättchen zum Schwingen. Mit begrenzter Songlänge von wenigen Sekunden, aber immerhin.
Der Tonträger war damals eigentlich noch keiner, es war eher ein Spielplan – eine festgehaltene Anleitung, wie die Spielmechanik zu reagieren hat, damit die Töne in der richtigen Reihenfolge und in den richtigen Abständen erzeugt werden. Anfangs des 20. Jahrhunderts wurde dann die Orgelstiftwalze durch ein Lochband ersetzt: eine Papierrolle, wo an den entsprechenden Stellen Löcher gestanzt waren. Dadurch konnten die Songlänge und das Repertoire massiv erweitert werden.
Im weitesten Sinn können die Drehorgel-Stiftwalze und das Lochband jedoch als eine Art erster digitaler Tonträger bezeichnet werden – die ersten Computerspeicherkarten waren ebenfalls Lochkarten.
Die ersten Tonträger
Und vor 136 Jahren erfüllte sich dann der Traum, gespielte Musik und Stimmen aufzuzeichnen, um sie dann zeitlich und auch örtlich versetzt, nahezu originalgetreu oder wenigstens erkennbar, und unabhängig von einem Instrument oder einer Person wiedergeben zu können. Dies war die Geburtsstunde des Tonträgers. Also ein Medium, das überhaupt nichts zu tun hat mit einem Instrument; aber so klingt, wenn man es in einem geeigneten Wiedergabegerät abspielt. Man muss sich einmal in diese Zeit zurückdenken und sich das vorstellen! Fan-tas-tisch!
Danach bis heute folgten stetige Verbesserungen und Neuerungen betreffend verwendeter Technik, Aufnahme- und Wiedergabequalität, Aufnahmedauer, Haltbarkeit, Handhabung etc.
Auch heutige Formate wie MP3 können ohne Weiteres immer noch als Tonträger bezeichnet werden, da sie genau diese Urfunktion immer noch erfüllen.
ab 1850
Verschiedene innovative Köpfe denken an der Realisierung des Telefons herum. Dabei ging es allerdings nur um Sprachübertragung, nicht um Aufzeichnung.
1857
Der Franzose Édouard-Léon Scott de Martinville erfindet zusammen mit dem Deutschen Rudolph König den Phonoautographen, womit erstmals Klänge aufgezeichnet, allerdings noch nicht wiedergegeben werden konnten. Technik: Membrane mit Schweinsborste zeichnet die Schwingungen auf einen russgeschwärzten Glaszylinder. Die älteste Aufnahme aus dieser Zeit stammt von 1860 und konnte erst 2008 «hörbar» gemacht werden.
Bei weiteren Apparaten wurde mit den Schallwellen eine Gasflamme moduliert und mit einem Spiegel sichtbar gemacht.
Der Schotte Alexander Graham Bell konstruiert 1873 ebenfalls einen Phonoautographen mit Russzylinder, allerdings nicht mit einer Membrane, sonder mit dem Ohr einer Leiche.
1877
Der Amerikaner Thomas Alva Edison erfindet den Phonographen, womit erstmals Klänge aufgezeichnet und wiedergegeben werden können. Technik: Membran mit Nadel auf Zinnfolienwalze. Wiedergabe mit einer Schalldose.
Gleichzeitig erfindet auch der Franzose Charles Gros, wenigstens theoretisch, einen Phonographen. Er lässt die Idee jedoch nicht patentieren.
Diktierphonographen waren noch bis in die 1950er Jahre in Büros im Einsatz.
1887
Der Deutsche Emil Berliner erfindet in Amerika die im Vergleich zu Zylindern einfacher kopierbare Schallplatte und gleichzeitig das Grammophon, womit die markttaugliche Serienreife von Tonträgern erstmals gegeben war. Technik: Aufnahme auf Russglassplatte, Vervielfältigung durch Zink-Platten auf vulkanisiertem Hartgummi. Berliner beginnt die Vermarktung seiner Erfindung zuerst in Deutschland, danach wieder in den USA, später in Kanada.
Bereits 1880 erfand der Amerikaner Charles Sumner Tainter das Prinzip der Schallplatte, verfolgte aber die Entwicklung seiner Wachsplatten infolge technischer Probleme nicht weiter.
1888
Der erste industriell hergestellte und erhältliche Tonträger. Basiert noch auf Edisons Phonographen. Technik: Wachszylinder. Spieldauer: 2 Minuten. Die Produktion wurde später von den Schellackplatten mehr und mehr verdrängt und 1929 ganz eingestellt.
1896
Berliner verbessert die Materialeigenschaften seiner Schallplatte mithilfe von Schellack. Damit gelingt der Schellackplatte und dem Grammophon der kommerzielle Durchbruch. Hergestellt bis Ende der 1960er Jahre. Umdrehungszahl, normiert ab 1920: 78 pro Minute. Spieldauer: etwas mehr als 4 Minuten pro Seite bei 30 cm Durchmesser, es waren aber unterschiedliche Durchmesser erhältlich.
1898
Der Däne Valdemar Poulsen erfindet die Schallaufzeichnung mittels eines magnetisierten Drahtes, was die Grundlage war für die spätere Entwicklung des Tonbands.
ab 1900
Die Schallplattenindustrie kommt so richtig in Schwung. Der italienische Tenor Enrico Caruso («O sole mio») war der erste weltweite Star der Industrie, mit Millionen verkaufter Platten.
1904
Die erste zweiseitig bespielbare Schallplatte wird veröffentlicht.
ab 1920
Radiostationen gehen überall auf der Welt auf Sendung.
ab 1925
Elektrische Tonabnehmer für Schallplatten treten ihren Siegeszug an.
1928
Der Österreicher Fritz Pfleumer erfindet in Deutschland das Tonband. 1935 erscheint das erste Magnettonbandgerät.
ab 1930
Das Schneiden und Nachbearbeiten von Schallplatten wird möglich.
1930
Die erste PVC-Schallplatte (Polyvinylchlorid=«Vinyl») wird veröffentlicht; die Findung eines geeigneten und günstigen Materials hatte lange Jahre in Anspruch genommen. Nun waren auch Umdrehungszahlen von 331/3 und 45 pro Minute möglich und damit längere Spielzeiten. Aus verschiedenen Gründen wurde die Vinylplatte jedoch weiterhin auf Eis gelegt; den kommerziellen Siegeszug begannen die Kunststoffscheiben erst 1948.
1931
Der Engländer Alan Dower Blumlein erfindet die Stereoaufnahme für Schallplatten, die erste Stereo-Schallplatte wird jedoch erst 1957 veröffentlicht.
ab 1963
Die ersten Musikkompaktkassetten und Kassettenrekorder sind erhältlich, entwickelt von Philips; ab 1965 auch mit Musik bespielt, ab 1967 auch mit Stereoton. Zuvor hatte sich das Tonband nur im professionellen Bereich durchgesetzt.
1965
Hauptsächlich in den USA, und dort hauptsächlich in Autoradios wird die 8-Spur-Kassette sehr populär und bleibt es bis Anfangs der Achtziger.
1979
Sony lanciert den ersten Walkman.
1982
Philips und Sony präsentieren die Audio-CD.
1984
Sony lanciert den ersten Discman. Aber erst die «joggingtauglichen» Versionen in den Neunzigern können den Kassetten-Walkman ablösen.
1985
Digital Audio Tape (DAT) wird entwickelt, kann sich dann aber nur im professionellen Bereich durchsetzen.
1992
Sonys MiniDisc und Philips/Matsushitas Digital Compact Cassette konkurrenzieren sich gegenseitig und wollen die analoge Kassette ersetzen. Einigermassen erfolgreich wird hingegen nur die MiniDisc, wobei sie in den meisten Ländern auch nicht annähernd den Erfolg von CD und Kassette erreicht.
1993
Das vom Fraunhofer Institut in Deutschland entwickelte MP3-Format wird veröffentlicht.
1996
Die DVD kommt auf den Markt. Obwohl im Prinzip möglich, findet die DVD als Audiomedium (= 26fache Kapazität einer Audio-CD) keine Bedeutung, sondern wird ausschliesslich für Video und später Computerdaten verwendet.
ab 1997
Erste Testangebote von Music-On-Demand übers Internet.
1998
Der erste MP3-Player kommt auf den Markt. Apple startet seine iPod-Serie 2001.
1999
Napster geht als erste Peer-to-peer-Tauschbörse online.
ab 2003
Die Musikindustrie geht online und bietet fortan ihre Produkte zusätzlich im Internet als Download feil. Anfänglich grösstenteils mit Kopierschutz, wurde dieser aber ab 2009 wieder eingestellt, aufgrund der überzahlreichen Kundenreklamationen.
heute
Als handfestes Medium besteht weiterhin die Audio-CD. Vinylplatten sind noch bei Fans und DJs gefragt. Kassetten sind als Kindermusikmedium und in gewissen Undergroundszenen als Demo- und Mixtapes auch heute noch verbreitet, in Schwellen- und Drittweltländern sogar als Audiomedium hauptsächlich.
Als virtuelles Medium konzentriert sich Audio mit verschiedenen Formaten und Angeboten inzwischen hauptsächlich auf den Smartphone- und Tabletmarkt; vor allem «Streaming on Demand» gewinnt an Bedeutung, da diese Geräte inzwischen ständig online sein können.
Was ist ein analoger Tonträger?
Auf einem analogen Tonträger sind die musiktragenden Schallwellen in der einen oder anderen Form immer noch als physikalisch messbare Schwingungen vorhanden. Bei der Schallplatte sind es die feinen Rillen mit unterschiedlichen Tiefen und Verläufen, mit denen die Nadel dann wiederum in Schwingungen versetzt wird. Bei der Musikkassette ist es das Band mit unterschiedlich magnetisierten Bereichen, auf die dann der Lesekopf eine elektrische Spannung legt, und so das Signal unterschiedlich stark verändert wird und an einen Lautsprecher weitergeleitet werden kann. Grob gesagt.
Bei analogen Tonträgern (und natürlich auch Aufnahme- und Wiedergabegeräten) wird also das Signal nur jeweils in eine andere Form umgewandelt.
Ein Pendant dazu ist die analoge Fotografie: das eintreffende Licht wirkt auf einen Zelluloid-Film, der unterschiedlich stark chemisch reagiert, und mit dem dann später das Fotopapier belichtet wird, welches wiederum chemisch reagiert und auf dem Papier abbildet, was die Fotolinse «gesehen» hat. Auch hier handelt es sich um eine reine Umwandlung, welche aber ebenfalls stark abhängig ist von verwendetem Material und Technik.
Verluste beim analogen Tonträger
Der Nachteil eines analogen Tonträgers: bei der Umwandlung des Signals entsteht jedesmal eine gewisse Verfremdung im Vergleich zur Originalschallwelle, da zwar die Schwingung grundsätzlich erhalten bleibt, aber physikalische Einwirkungen von aussen das Signal beeinflussen können und dies auch tun, und abhängig von verwendeter Technik und Material bei der Umwandlung gewisse Frequenzen schlicht «verloren» gehen können.
Was aber deswegen nicht immer auch schlecht klingen muss. Die Schallplatte erfreut sich bei DJs und Hi-Fi-Enthusiasten nach wie vor grosser Beliebtheit. Rein physikalisch gesehen ist jedoch analoge Umwandlung im Vergleich zur Originalqualität immer ein Verlust. Daher ist es auch oberstes Gebot der analogen Audiotechnik, diese Umwandlung und die Beanspruchung des Materials möglichst wenige Male durchzuführen und möglichst hochwertige Technik zu verwenden, um die Verluste gering zu halten.
Für den Normalkonsumenten erschwingliche Aufnahme- und Abspielgeräte auf analoger Basis waren etwa ab den Siebziger Jahren auf einem dem menschlichen Hörvermögen genügenden Qualitätslevel. Was aber nicht bedeutet, dass alles Frühere schlecht geklungen hat: das menschliche Gehirn kann sich sehr schnell an ein Hörspektrum «gewöhnen» und trotz eingeschränkter Qualität etwas als «schön» empfinden.
Nicht unbeschränkt haltbar
Ein weiterer Nachteil der analogen Tonträger ist die beschränkte Haltbarkeit. Die aufgezeichneten Schwingungen sind, da sie ja noch physikalisch vorhanden sind, auch physikalischen und chemischen Einflüssen ausgesetzt und können so im Laufe der Zeit ihr Schwingungsbild verändern beziehungsweise dadurch an Qualität verlieren. Oder sich auch ganz auflösen: ein Grossteil der Tonträger aus dessen Anfangszeit hat sich inzwischen zersetzt und ist nicht mehr abspielbar.
Gewollte Qualitätsverluste
Den grössten Nachteil der analogen Tonträger hat die Musikindustrie wiederum für sich als Vorteil genutzt. Eine Schallplatte konnte man nicht selbst herstellen, aber als in den Sechziger Jahren die Musikkassette und Kassettenrekorder aufkamen, begannen die Leute fleissig, Musik voneinander auch zu kopieren. Um dem entgegenwirken zu können, wurde die Qualität der für den Normalkonsumenten erhältlichen Leerkassetten bewusst tief gehalten, damit sich die Qualitätseinbussen spätestens nach dem zweiten Kopieren bemerkbar machten und nach einigen Malen die Kopien schier unhörbar wurden.
Dies war übrigens auch bei den VHS-Kassetten der Fall. Dort allerdings war nur die Qualität der gekauften Filme bewusst schlecht; damit die Filme nicht beliebig oft untereinander weitergegeben werden konnten – nach einigen Malen Anschauen nahm die Bildqualität rapide ab. Die Rohlinge zum selbst aufnehmen waren besser, da ja die allermeisten das Fernsehsignal aufzeichneten und kaum jemand zwei Videorekorder besass, um Filme zu kopieren.
Was ist ein digitaler Tonträger?
Auf einem digitalen Tonträger sind keine physikalisch messbaren Schwingungen mehr vorhanden, die einen direkten Zusammenhang mit den Luftschwingungen (= der Musik) haben. Sondern Informationen, die aus den analogen Schallwellen interpretiert wurden, und mit denen bei entsprechender Auswertung der Verlauf der Schallwellen rekonstruiert und dann analog wiedergegeben werden kann.
Fürs Archivieren und die Wiedergabe gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten: entweder die ankommende Schallwelle wird in kleinsten Zeitabständen gemessen und die jeweilige Position registriert. Das ergibt dann eine Art «zerstückelte» Welle. Diese Methode kommt bei praktisch allen digitalen Formaten zur Anwendung.
Das Pendant dazu in der digitalen Bildwelt ist ein «Bitmap»-Bild. Also ein Gitternetz mit lauter Pixeln, wo jedem Pixel eine Farbe zugeordnet ist. Was bei allen Fotos, JPEGs etc. der Fall ist. Die Bildauflösung (z. B. 12 Megapixel) wäre dann das Pendant zur Samplingausflösung beim digitalen Ton (z. B. 44,1 kHz), und die Farbtiefe (z. B. 24 bit) das Pendant zur Samplingtiefe (z. B. 16 bit).
Die andere Methode ist die Erzeugung und Wiedergabe mittels einer Schallkurve, wo die Schwingungen mit Vektoren und Formeln definiert sind. Dies ist aber einzig bei digitalen Synthesizern und Stimmengeneratoren der Fall.
Das Pendant in der Bildwelt sind Vektorgrafiken, wo in einem Koordinatensystem ausschliesslich Linien mathematisch definiert sind, mit den zugehörigen Attributen wie Farbe und Linienstärke. Dies ist bei Logos, Plänen und Schriften der Fall.
(Die Aufzeichnung mittels solcher Vektoren wäre übrigens gar nicht direkt möglich, sondern muss erst aus einer digital aufgenommenen, «zerstückelten» Schallwelle errechnet werden. Ausserdem würde ein «vektorisiertes» Wellensignal bei hochfrequentiger Qualität nur unwesentlich weniger Dateigrösse brauchen als ein «zerstückeltes», daher ist diese Methode auch für die Soundkomprimierung nicht interessant. Dies nur so am Rande.)
Aufnahme, Speichern und Wiedergabe
Aufgenommen wird digitale Musik genau gleich wie analoge: mit einem Mikrofon für den Sänger und einem Jack-Kabel für den Gitarristen. Allerdings hockt am anderen Ende kein Bandgerät, sondern ein A/D-Umsetzer (Analog-Digital-Umsetzer), der mit einer bestimmten Abtastrate das Signal analysiert und diese Pegelwerte gemäss eingestellter Bittiefe als Zahlen weitergibt.
Diese Informationen werden nun in einem Format abgespeichert, die auch wieder so gelesen werden können. Das geschieht (zumindest bis jetzt) ausschliesslich mit dem sogenannten binären Zahlensystem, also einer Zahl mit Einsen und Nullen. Denn das versteht der CD-Player und der Computer dann auch wieder. Daher der Ausdruck «digital», von «digit» = «Ziffer» auf englisch. Digitale Daten sind also so etwas wie ein Morsecode – der ja auch nur aus kurzen und langen Signalen besteht.
Sobald gelesen, gibt das Abspielgerät die Daten weiter an den D/A-Umsetzer (Digital-Analog-Umsetzer), der aus dem digitalen Nummernchaos wieder eine «echte» Schwingung generiert, welche er dann als analoges elektrisches Signal zum Beispiel an den Kopfhörerausgang sendet.
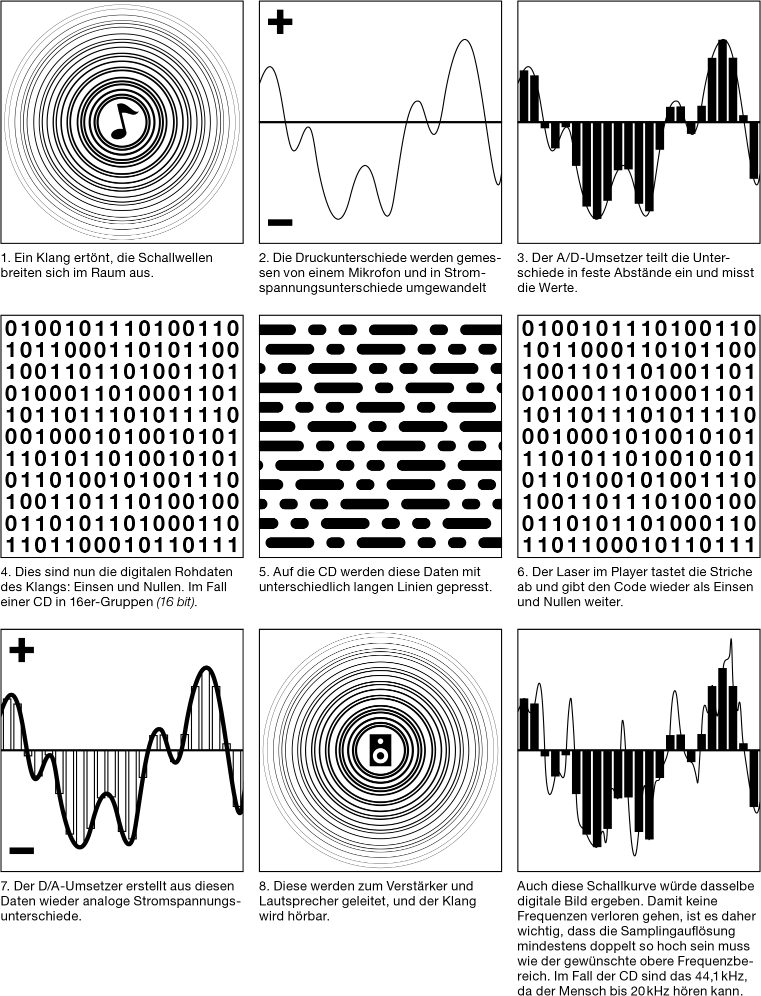
Nachteil: Nicht mehr analog
Der einzig nennbare Nachteil von digitalisierter Musik für den Hörer ist das Prinzip selbst: die aufgezeichneten Schallschwingungen sind keine «echten» Schwingungen mehr, sondern Interpretationen. Dadurch verliert man den physischen «Draht» zum Original und ist abhängig von der Qualität der Digitalumsetzer. Zwar ist mit den heutigen digitalen Systemen auch die beste analoge Tonträgerqualität rein rechnerisch nicht nur erreicht, sondern längst überschritten.
Aber Hi-Fi-Freunde (Hi-Fi = High Fidelity = Hohe Klangtreue) und Plattenleger schwören nach wie vor auf die schwarzen Vinylscheiben. Sicher zum einen wegen der Haptik: die Handhabung einer Platte ist, ob beim Auflegen oder beim Scratchen, handfester und direkter als diejenige einer CD, welche man ins Gerät schiebt und ja meistens während der Laufzeit nicht einmal sehen geschweige denn von Hand kontrollieren kann. Zum anderen aber sicher auch, da die Platte eben ein echtes «Abbild» des Originals ist und daher eigentlich die höhere «Klangtreue» aufweist als irgendein digitales Medium. Nicht rein rechnerisch mit messbarem Klangspektrum, sondern physisch-materiell. Und natürlich auch nur, wenn während des Produktionsprozesses ausschliesslich analoge Geräte zum Einsatz kamen.
Ob man dies hören kann oder nicht, darüber wurden bereits unzählige Diskussionen geführt, die meisten davon sehr emotional. Fest steht: Musik hat beim schlussendlichen Hören nicht mehr viel mit reiner Mathematik zu tun, sondern wird bei jedem Menschen individuell anders empfunden und löst entsprechende Gefühle aus oder eben nicht. Und es gibt Leute, die hören mehr oder anders als andere. Und: ein analoger und ein digitaler Tonträger sind ganz einfach zwei völlig unterschiedliche Dinge. Daher kann die Frage, ob analog oder digital nun besser klinge, auch nie abschliessend beantwortet werden. Muss sie ja auch nicht.
Nachteil: die Latenz
Wenn analoges Signal zu digitalem umgewandelt wird und umgekehrt, entsteht immer eine sogenannte Latenz. Dies ist die Verzögerungszeit, die der Prozessor und die D/A-Umsetzer benötigen, um die Daten zu messen und zu verarbeiten respektive daraus wieder ein Wellensignal zu generieren. Sobald die Musik läuft, merkt man nichts mehr von der Latenz; sie hat nur Auswirkung auf den Startpunkt, ist also die «Reaktionszeit». Kein Problem für den Endkonsumenten. Aber bei der Musikproduktion und -kreation fällt die Verzögerung ins Gewicht und muss zwingend berücksichtigt werden. Obwohl sich die Latenz im Bereich von wenigen Milisekunden bewegt, kann sich das bei gleichzeitigem Aufnehmen von mehreren Instrumenten auch addieren und so die Verzögerungen deutlich hörbar machen.
Daher müssen parallel angehängte digitale Studiogeräte und Instrumente entsprechend synchronisiert werden, um die «Gleichzeitigkeit» zu gewährleisten. Ausserdem entsteht dort schnell viel Latenzzeit, wo viel gerechnet werden muss, wie bei Software-Synthesizern. Bei Geräten, die nacheinander gekoppelt sind, addiert sich die Latenz sogar zwingend und muss entsprechend korrigiert werden. Dies kann beispielsweise ein Problem sein bei MIDI-Signalen, da dort die Noten nacheinander gesendet werden, auch wenn sie gleichzeitig gespielt wurden.
Beispiel: Latenz einer durchschnittlich-guten Soundkarte: 7 Millisekunden. Das entspricht doch immerhin mehr als 2 Metern Entfernung aus Sicht der Schallgeschwindigkeit.
Die Latenzzeit kann zwar bei digitalen Geräten mit schnellerer Prozessorleistung und klugen Interfaces optimiert werden. Allerdings nie ganz bis Null. Analoge Geräte und Instrumente haben dieses Problem nicht. Sie senden und verarbeiten ihre Signale immer im Jetzt, also mit annähernder Lichtgeschwindigkeit. Eine Verzögerung ist weder spür- noch relevant messbar.
Nachteil: Clipping
Der Dynamikbereich von digitalen Musikdaten ist naturgemäss streng limitiert. Der maximale Lautstärkepegel hört bei – 0 dB auf; sollte es weitergehen, wird die Schallwelle einfach abgeschnitten. Dies ist zwar, wenn alles richtig gemacht wird, auch kein Problem. Bei der digitalen Musikproduktion muss aber streng auf diese Limite geachtet werden, da sonst sehr unangenehme Verzerrungen entstehen, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Bei den meisten heutigen Produktionen wird Clipping leider bewusst in Kauf genommen, siehe Kapitel «Lautheitskrieg».
Auch bei der analogen Musikbearbeitung und -kreation achtet man natürlich auf diese Limite. Allerdings ist es dort weniger dramatisch, wenn gewisse Peaks das oberste Level überschreiten, da ein analoges Aufnahmemedium immer noch eine akzeptable Toleranzschwelle hat, die über – 0 dB liegt. Die dadurch entstehende Verzerrung wird vom menschlichen Ohr erst ab einer gewissen Stärke als störend empfunden. Und dann gibts noch den Fall, wo bei der Wiedergabe genau diese analoge Verzerrung gewünscht ist: bei der verzerrten E-Gitarre.
Vorteil: Kopieren ohne Verlust
Da die Schallwelle nun ja als reine mathematische Information vorliegt, kann diese Information auch beliebig oft kopiert werden, ohne jeglichen Qualitätsverlust. Kopie und Original sind identisch; eine digitale Kopie könnte man also auch als «Klon» bezeichnen.
Dadurch gibt sich auch die Möglichkeit, die Musik auf beliebige Datenträger abzuspeichern, solange diese fähig sind, Nullen und Einsen zuverlässig abzuspeichern. Und das sind praktisch alle Medien. Man könnte also auch ein Blatt Papier mit 0 und 1 vollschreiben und hätte somit eine digitale Kopie erstellt (Was natürlich bei einer CD-Länge recht aufwändig wäre: fünfeinhalb Milliarden Zeichen!). Dies macht gleichzeitig eine dauerhafte und zuverlässige Archivierung von Musik überhaupt erst möglich. Und zeigt sich auch bei der Qualität bei wiederholtem Abspielen, da nun ein passender Datenträger entworfen werden konnte, der mechanischen und sonstigen physikalischen und chemischen Einflüssen besser Stand hielt: eine CD ist beispielsweise viel weniger anfällig auf Kratzer und Verschleiss als eine Schallplatte.
Vorteil: Verschiedene Systeme möglich
Da man mit digitalen Daten quasi vom Medium unabhängig ist, können auch beliebig viele Datenträger-, Aufnahme- und Abspielsysteme entworfen werden, je nach Funktionsumfang, Qualitätsanspruch und Preissegment. Auch wenn es bereits gewisse «exotische» Vorstösse gab in diese Richtung: bewährt hat sich, wenn die Hersteller sich zumindest beim Konsumenten-Endformat auf einen oder wenige Standards einigen können.
Vorteil: Qualität nach oben offen
Ausserdem kann die Auflösung von digitalen Daten und damit die Qualität beliebig verfeinert werden und ist nur gebunden an die Prozessorgeschwindigkeit der jeweiligen Geräte. Für die Endqualität ist dies zwar nicht von Belang – das menschliche Hörspektrum war bereits mit der Qualität der Audio-CD genügend abgedeckt. Aber für die Bearbeitung und Kreation der Musik ist das von zentraler Bedeutung, da man nun selbst bei Veränderungen im Produktionsprozess (Equalizer, Kompressoren, Effekte) keine Verluste einstecken muss.
Vorteil: Unabhängigkeit vom Medium
Digitale Musik kann völlig losgelöst von einem bestimmten Medium in ein anderes umgewandelt werden ohne Qualitätsverlust. Und es funktioniert selbst ohne Medium, denn die nackten Daten lassen sich virtuell oder verstückelt versenden und an einem anderen Ort wieder empfangen, ebenfalls ohne Verlust (Das war grundsätzlich natürlich nichts Neues: auch analoge Musik kann man mit Radio über weite Distanzen übertragen; allerdings ist dort die Übertragung verlustbehaftet und der Senderadius eingeschränkt.). Das tatsächliche Potenzial dieser Eigenschaft zeigte sich aber dann erst mit der Möglichkeit der Komprimierung und mit der Verbreitung des Internets.
Vorteil: Metadaten
Digitale Musikdaten lassen sich auch beliebig erweitern mit zusätzlichen Information wie Songname, Name des Künstlers, Datum etc. Dies sind die sogenannten Metadaten, auch genannt Tag-Informationen (gesprochen: «Täg»).
Vorteil: Komprimierung möglich
Zu Computerzeiten, wo Speicher noch ein knappes Gut und Internetleitungen langsam waren, wurde nach Möglichkeiten gesucht, Daten ohne oder möglichst ohne wahrnehmbaren Verlust stark verkleinert speichern zu können, um Platz auf dem Datenträger zu sparen und sie schnell versenden zu können. So geschehen mit digitalen Bildern, ein daraus entstandenes Dateiformat ist zum Beispiel das überall verbreitete JPEG. Auch für Musikdaten suchte man nach entsprechenden Algorithmen, was zur Erfindung von MP3 führte. Doch dazu auf den nächsten Seiten mehr. Jedenfalls hat die Digitalisierung und die später eingeführte Möglichkeit der Komprimierung von Musik die heutige globale Verbreitung und Vielfalt von Tonträgern überhaupt erst ermöglicht.
Der Durchbruch der CD und damit des digitalen Tonträgers
Nach Einführung der Audio-CD im Jahr 1982 zeigte sich schnell, dass für die meisten Endnutzer die Vorteile die Nachteile deutlich überwiegen. Mit dem steigenden Angebot und den gleichzeitig fallenden Preisen von CD-Abspielgeräten löste die CD die Schallplatte innert weniger Jahren als Hauptmedium ab und bescherte der Musikindustrie in den Neunzigern einen einmaligen, riesigen Boom. Nicht nur dank neuem Publikum und der einfacheren Handhabung, sondern auch, weil viele die Musik nochmals neu als CD kauften, da die alte Plattensammlung ja schon in die Jahre gekommen und vielleicht auch ein wenig zerkratzt war. Und als die Discman nahezu «schüttelfrei» wurden, lösten sie auch schnell den Walkman als transportablen Player ab.
Eine kleine Anekdote zur Entwicklung der Audio-CD: sie wurde von der niederländischen Philips und der japanischen Sony erfunden und als gemeinsamer Standard entwickelt. Ursprünglich war sie als Ersatz zur Schallplatte geplant und sollte, um von den Konsumenten schneller akzeptiert zu werden, die gleichen Dimensionen haben. Also 30 cm Durchmesser! Allerdings hätte so auf einer CD 13,3 Stunden Musik Platz gehabt; den Entwicklern wurde schnell klar, dass die Musikindustrie kein Interesse haben würde an einem derart umfangreichen Tonträger. So wurde sie kleiner gemacht, genauer gesagt 0,5 cm grösser als die Diagonale der beliebten Musikkassette.
Um die scheinbar willkürliche Länge von 74 Minuten hält sich zudem das Gerücht, dass Sonys damaliger Vizepräsident sich schon immer gewünscht hatte, Beethovens Neunte Sinfonie am Stück hören zu können. Und die damals längste Aufnahme dieser Sinfonie dauerte eben genau 74 Minuten.
Dass sie damals recht hatten mit der Marktuntauglichkeit eines grösseren CD-Durchmessers, zeigt sich darin, dass Kauf-CDs auch 30 Jahre nach ihrer Einführung selten zu mehr als zwei Dritteln «gefüllt» sind.
Ab der Jahrtausendwende begann der CD-Boom der Jahre zuvor zu stagnieren und dann zu sinken. Hauptsächlich nicht wegen «Raubkopierern», sondern wegen der Verlagerung des Tonträgermarkts in Richtung online und damit Formaten wie MP3, weg von der Stereoanlage in Richtung Computer und Smartphone. Die CD ereilt dasselbe Schicksal wie die Schallplatte und die Tonträger davor: sie wird abgelöst durch ein zeitgemässeres Medium und bleibt fortan nur noch von Fans dieses Mediums gefragt.
Übrigens: auch die Entsorgung einer CD kostet. Und da die Musikindustrie dem tatsächlichen Tonträgertrend ständig hinterherhinkt, sogar einiges: EMI gab 2008 bekannt, dass sie das Einstampfen nicht verkaufter CDs jährlich 50 Millionen (!) Franken kostet. Dies entspricht ungefähr 2 % des gesamten damaligen Jahresumsatzes von EMI.
Der fragwürdige CD-Kopierschutz
Um die verlustfreien CD-Kopien mittels Computer zu verunmöglichen, hat die Musikindustrie Anfangs des neuen Jahrtausends begonnen, Kauf-CDs mit einem Kopierschutz zu versehen. Davon gibt es verschiedene Varianten. Letztendlich bedienen sich aber alle irgendeines Tricks, um das Auslesen der CD dem Computer zu verumöglichen, gleichzeitig dem CD-Player aber eine «echte» CD vorzutäuschen. Denn im damals festgeschriebenen Standard für Audio-CDs war und ist kein Kopierschutz vorgesehen. Alle Kopierschutzvarianten umgehen also diesen Standard mehr oder minder massiv. Da die Industrie aber in diesen Fällen jeweils keine echten Compact-Discs (erkennbar am
Symbol ![]() ) als Alternative anbietet, handelt sie aus konsumentenschützerischer Sicht selbst in einem dunkelgrauen Bereich.
) als Alternative anbietet, handelt sie aus konsumentenschützerischer Sicht selbst in einem dunkelgrauen Bereich.
Denn die kopiergeschützten CDs lassen sich längst nicht in allen Playern abspielen. Namentlich Autoradios haben ihre grösste Mühe damit. Was natürlich nicht gerade zur Freude der erwartungsvollen Hörer ist – schliesslich hat man sich die CD nicht nur zum Anschauen gekauft.
Alben, Singles und Strategien der Majors
An dieser Stelle einige erklärende Informationen zur Frage: Was ist eigentlich ein Album, und was ist eine Single? Und was bedeuten sie für den Musikmarkt?
Anfangs gab es nur Singles. Also einzelne Songs. Weil ganz einfach auf den Tonträgern nicht mehr Spielzeit vorhanden war. Erst mit dem Durchbruch der Vinylschallplatte in den Fünfziger Jahren war es möglich, mehrere Songs am Stück zu hören, ohne den Tonträger wechseln zu müssen. Genial! So ward das Album geboren, auch genannt Long-Player (LP). Nebst anderer positiven Eigenschaften der Vinylplatte bescherte diese der Musikindustrie einen grossen und lang anhaltenden Boom, der gleichzeitig einherging und natürlich auch zusammenhängt mit der Einführung des globalisierten Massenpops. Mitte der Sechziger Jahre kam dann noch die Musikkassette dazu und erreichte bald ebenso grosse Beliebtheit.
Wie ging es weiter? Die Bedeutung des Albums im Vergleich zur Single wurde immer wichtiger. Bei den Konsumenten, weil man so mehr Hörvergnügen kriegt fürs Geld, und bei den Labels, weil sie mit einem Album viel mehr Umsatz machen als mit einer Single und zudem die Gewinnmarge deutlich höher ist. Ab den späten Sechzigern änderten die Major-Labels ihre bisherige Strategie, und die Single wurde hauptsächlich als «Test» für neue Künstler gesehen. Wenn sie und vielleicht auch noch die zweite sich gut verkauften, wurde danach auch ein Album aufgenommen. Bei den bereits erfolgreichen Künstlern hatte die Single schon längst den reinen Werbestatus fürs Album erreicht; der Single-Umsatz selbst spielte nur noch eine Nebenrolle. Obwohl auch bereits zu dieser Zeit und fortwährend herausragende Konzeptalben produziert wurden, waren vor allem im Mainstreambereich für den Konsumenten jeweils nur wenige Tracks eines Albums interessant, der Rest wurde als «Füller» empfunden. Was natürlich sehr oft auch solche waren; der Fokus in der Produktion und somit des Budgets lag schliesslich auf den Singles. Daher entstanden mit der Zeit die «Hit-Compilations» mit Songs verschiedener Künstler, da man so wieder die Qualitätsdichte auf den Alben erhöhen konnte.
Ebenfalls Ende der Sechziger Jahre fand eine andere strategische Neuausrichtung der Major-Labels statt, die ihre Auswirkungen bis heute zeigt: die Stilrichtungen. Zuvor wurde der Markt nur in wenige Segmente aufgeteilt. In den USA, welche damals mit Abstand den grössten Anteil am Weltmarkt hatten, gab es beispielsweise etwa vier Kategorien: weisse Musik, schwarze Musik, Klassik und Weiteres. Nun hatten die Majors aber entdeckt, dass sich mehr Absatz generieren lässt, wenn man die Zielgruppen individueller und direkter mit ihrem Musikgeschmack anspricht: die Folge waren Begriffe wie «Country», «Folk», «Hard Rock» und «Heavy Metal».
Das war ein voller Erfolg. Allerdings wurde die Stilsegmentierung zur Retourkutsche für die Majors: Viele kleine Independent-Labels brachten immer mehr immer neuere Genres heraus: Disco, Punk, Hip-Hop, Electronic etc., welche schnell grossen Anklang beim Publikum fanden. Dadurch schrumpften die Umsätze der Majors bei den bestehenden Segmenten, bei denen hiermit das Stammpublikum «abgegrast» wurde. Das kann nebst anderem als Ursache angesehen werden für die weltweite Krise, in die die Musikindustrie Ende der Siebziger Jahre schlitterte.
Die Folge davon waren «Prince, Madonna, Cher». Die Majors konzentrierten sich nun in den Achtzigern vermehrt nicht mehr auf alle Segmente, sondern nur noch auf wenige, und da vor allem auf einzelne Aushängeschilder: der Superstar war geboren.
Die goldenen Zeiten. Die Umsätze stiegen kontinuierlich, ebenfalls begünstigt durch die rasch ansteigende Beliebtheit der neu erschienenen CD, die Majors waren glücklich, und die Independent Labels ebenfalls. Der Boom erreichte die Spitze in der zweiten Hälfte der Neunziger, danach kam alles anders.
Zurück zum Album: dessen Bedeutung im Vergleich zur Single stieg ebenfalls ungebrochen an. Jahrelang machten Albumkäufe annähernd 90 % des Umsatzes aus. Seit Songs aber seit 2003 online auch einzeln und zudem zu einem viel tieferen Preis als eine herkömmliche Single-CD gekauft werden können, macht dieses Verhältnis kehrt. Die Alben verschwinden mehr und mehr vom Markt. Musikkonsumenten sind nach wie vor begeistert von Musik und geben dafür Geld aus. Da aber die Industrie an einer Single viel weniger verdient, zeigt sich das eben auch in den Umsatz- und vor allem auch in den Gewinnzahlen.
Weltweite Verkäufe von Tonträgerformaten
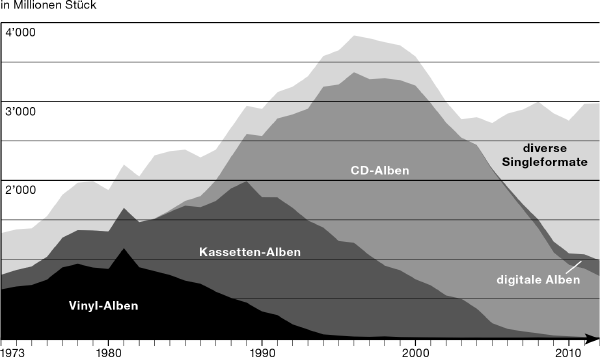
MP3 & Co. – die komprimierten Soundformate
Ein wenig Vorgeschichte
Zu den Anfangszeiten der digitalen Musikdaten in den Achtzigerjahren konnte man noch nicht einmal im Traum daran denken, was für gewaltige Speicherkapazitäten wir heute zur Verfügung haben würden. Als die Audio-CD im Markt eingeführt wurde, waren die Festplatten erst einmal gerade daran, von der Bauweise her auf die heutige Grösse zu schrumpfen. Die damals erhältlichen Festplatten konnten bis zu 30 MB speichern und kosteten einige tausend Franken.
Eine CD konnte also mehr als zwanzig mal so viel Daten speichern und kostete nur einen Bruchteil davon. Trotzdem wurde die CD als reines Audio-Medium konzipiert und hatte anfänglich im Computerbereich keine Bedeutung, da die damaligen Computer gar noch nicht in der Lage waren, so viele Daten aufs Mal zu bearbeiten. Und da die CD eben nur gelesen, aber nicht beschrieben werden konnte, denn damals gab es noch keine CD-Brenner. Obwohl die Audio-CD vom Medium her schon alle technischen Anforderungen für den späteren Durchbruch der CD-ROM erfüllte, war ganz einfach die Computer-Infrastruktur noch nicht bereit dafür. Dies änderte sich dann erst ein paar Jahre später Anfangs der Neunziger Jahre.
Dass heute tausende CDs und in komprimierter Form zehntausende CDs auf einer einzigen Harddisk Platz haben würden, war damals also schlicht unvorstellbar.
Die Entwicklung von MP3
Und doch war es dann irgendwann soweit, die Festplatten wuchsen in der Kapazität kontinuierlich, die Prozessorgeschwindigkeiten ebenso. Und das Internet gab es bereits seit den Siebziger Jahren; virtueller Datenaustausch wurde immer schneller und wichtiger. Das bedingte aber auch, dass Daten verkleinert werden können müssen, um sie in angemessener Zeit verschicken zu können. Daher begann man in den Achtzigerjahren mit der Entwicklung einer Methode, Audiodaten ohne hörbare Verluste zu komprimieren. Das Resultat ist das Verfahren MPEG-1 Audio Layer III, besser bekannt als MP3, veröffentlicht Anfangs der Neunziger Jahre. Erfunden wurde es in Deutschland am Fraunhofer-Institut, welches auch den Grossteil der damit verbundenen Patente besitzt: Wer MP3s kostenpflichtig anbietet (oder auch Games mit MP3s oder MP3-Player herstellt), muss Lizenzgebühren bezahlen; der Ansprechpartner dafür ist das Unternehmen Technicolor.
Zum letztendlichen Durchbruch verholfen hat dem MP3-Format auch das WorldWideWeb, so wie wir es heute kennen. Es wurde um 1990 erfunden (übrigens in der Schweiz respektive Frankreich, beziehungsweise genau auf der Grenze, nämlich am CERN in Genf, von einem britischen Wissenschaftler) und begann, populär zu werden und rasch zu wachsen. Nun konnten auch Musikdateien schnell und mit akzeptablen Verlusten übers Netz ausgetauscht werden.
Inzwischen wurden auch weitere Verfahren entwickelt, die MP3 punkto Komprimierungsqualität noch überbieten. Das am meisten verbreitete Format ist jedoch nach wie vor MP3, da es von grundsätzlich allen Playern gelesen werden kann.
Wie MP3 funktioniert
Die Funktionsweise von MP3 basiert auf der sogenannten psychoakustischen Wahrnehmung, also der Tatsache, dass das menschliche Ohr und Gehirn gewisse Frequenzen oder Frequenzabfolgen nicht bewusst wahrnehmen können respektive «richtig» interpretieren, selbst wenn sie nicht vorhanden sind. So kann man also die Audiodaten auf diejenigen reduzieren, die wir auch bewusst wahrnehmen können; trotzdem bleibt das Gesamtklangbild für das menschliche Empfinden scheinbar unverändert. Dieses Prinzip kommt auch bei den meisten anderen Audio-Kompressionsverfahren zur Anwendung. Die Kompressionsstärke und damit auch die Wiedergabetreue lässt sich nach Wunsch einstellen.
Bei MP3 wird der Qualitätsverlust bei weniger als 96 kBit/s deutlich hörbar; Hörtests haben ergeben, dass bei Raten von mehr als 192 kBit/s kein Qualitätsunterschied zum Original mehr feststellbar ist. Höhere Datenraten finden also nur dort Anwendung, wo es um die Weiterverarbeitung von Musikdaten geht. Bei der Musikproduktion selbst wird jedoch wenn immer möglich mit unkomprimierten Daten gearbeitet.
Übersicht der am meisten verbreiteten Audioformate
| Name | häufigste Dateiendung |
voller Name | Geschichte | entwickelt von | Bemerkung |
| PCM |
keine (ist keine Datei) |
Puls-Code-Modulation | ab den 30er Jahren entwickelt, 1938 patentiert. 1971:
erste veröffentlichte digitale Aufnahme. 1982: Durchbruch mit der CD |
Alec Reeves, Bell Laboratories |
Das «Urformat» der digitalen Audiodaten auf einer CD, quasi die Rohdaten. Unkomprimiert, verlustfrei. |
| AIFF | .aiff .aif |
Audio Interchange File Format |
ab 1988 | Apple | Verlustfrei extrahierte Audiodaten einer CD, unkomprimiert. Gleichwertig wie WAVE. |
| WAVE | .wave .wav |
Waveform Audio File Format |
ab 1991 | Microsoft, IBM |
Verlustfrei extrahierte Audiodaten einer CD, unkomprimiert. Gleichwertig wie AIFF. |
| ALAC | .m4a* .mp4* |
Apple Lossless Audio Codec |
ab 2004 | Apple | Verlustfrei, komprimiert. Freies Format. |
| FLAC | .flac | Free Lossless Audio Codec |
ab 2001 | Xiph.Org-Stiftung | Verlustfrei, komprimiert. Freies Format. |
| MP3 | .mp3 | MPEG-1 Audio Layer III | ab 1993 | Fraunhofer Gesellschaft |
Komprimiert, verlustbehaftet. Nach wie vor das am häufigsten lesbare Audioformat. |
| AAC | .m4a* .aac .mp4* .3gp |
Advanced Audio Coding |
ab 1997 | Bell Laboratories, Fraunhofer Gesellschaft, Dolby Laboratories, Sony, Nokia |
Komprimiert, verlustbehaftet. Komprimiert besser als MP3. Standardkompression auf Apples iGeräten und Sonys PS3 |
| WMA | .wma | Windows Media Audio | ab Ende 90er Jahre | Microsoft | Komprimiert, normalerweise verlustbehaftet. Sehr verbreitet auf Software-Playern, weniger auf tragbaren Geräten. |
| Vorbis | .ogg | Ogg Vorbis | ab 2000 | Xiph.Org-Stiftung | Komprimiert, verlustbehaftet. Komprimiert besser als MP3. Freies Format. Auf Playern wenig verbreitet. |
| *Dateiendungen können manchmal unterschiedliche Formate enthalten. | |||||
Mit der Digitalisierung von Musik wurde sie vom Medium unabhängig, allerdings wird nach wie vor ein Tonträger benötigt, und sei dies eine MP3-Datei. Das nun vorläufig letzte Kapitel der Tonträgergeschichte ist dessen Verschwinden, wenigstens beim Hörer selbst: beim Streaming wird kein Tonträger mehr benötigt, stattdessen werden die Daten live und direkt übertragen und abgespielt. Natürlich muss irgendwo der Tonträger noch vorhanden sein, allerdings nur bei der «Sendestation».
Streaming begann als erstes, mit den sogenannten Internetradios populär zu werden. Das sind zwar keine «Radios» mehr im ursprünglichen Sinn, da ja keine Radiowellen gesendet werden. Doch das Prinzip des fortlaufenden Anbietens von Musik ist dasselbe. Um auch bei langsameren Verbindungsgeschwindigkeiten zu funktionieren, wird das ebenfalls mit verlustbehafteter Kompression gemacht. Das MP3 oder das entsprechende Format wird also quasi nicht mehr als ganze Datei empfangen, sondern Stück für Stück live übertragen und beim Empfänger fortlaufend in hörbare Musik zurückverwandelt.
Weiter gibt es den DAB-Standard (Digital Audio Broadcasting), der nach dem selben Prinzip funktioniert, allerdings die Daten nicht übers Internet versendet, sondern mit klassischen Radiowellen ausstrahlt.
Eine andere Anwendung von Streaming ist das digitale Radio und das digitale Fernsehen über Kabel beziehungsweise Satellit.
Diese Streaming-Methoden funktionieren alle in Echtzeit, was bedingt, dass die Sendestation auch fortwährend Musik spielt. Wie beim klassischen Radio halt.
Streaming auf Abruf
Was nun neu stark am aufkommen ist und die nächsten paar Jahre prägen wird, ist «Streaming on demand», also das Abspielen der Musik auf Abruf, die dann von einem Server zur Verfügung gestellt wird. Das neue Musikmotto heisst «Abrufen anstatt besitzen». Alle Computersysteme und die meisten Mobiltelefone sind oder werden rein technisch gesehen schon seit Jahren darauf vorbereitet.
Die Musikindustrie selbst, und damit eng verknüpft auch bedienerfreundliche Software und Abspielgeräte, hinken der Entwicklung ein wenig hinten nach: bei einem regulären Kauf im Online-Shop lädt man nach wie vor die gesamte Datei herunter. Handy-Applikationen und Online-Portale sind jetzt erst im Aufkommen. Auch bei der Filmindustrie hat es einige Jahre zu lange gedauert: inzwischen hat sich aber «Video on demand» bereits einigermassen etabliert und wird noch einiges an Bedeutung, Funktionsumfang und Bedienerfreundlichkeit gewinnen.
Der letzte Schritt in dieser ganzen Entwicklung wird sein, dass nicht einmal mehr auf dem Server ein Tonträger gespeichert sein muss. Die Audiodaten der gewünschten Musik werden dann mittels Echtzeit-Peer-to-Peer-Netzwerken fortlaufend «zusammengesammelt» und rekonstruiert werden. Was bedeutet, dass der Tonträger nirgendwo mehr als Ganzes vorhanden, sondern verstückelt in einzelne Bits auf der ganzen Welt verteilt sein wird. Und somit im eigentlichen Sinne nicht mehr existiert.
Ruhe in Frieden.
Dies wird die Zeit sein, wo selbst MP3-Dateien nur noch Liebhaberwert haben und von Nostalgikern in sauber geordneten Sammlungen gehegt und gepflegt werden, wie das bereits seit längerem bei Schallplatten und ja eigentlich heute auch schon bei CDs der Fall ist.
![]()
